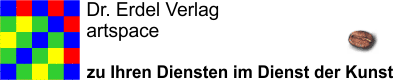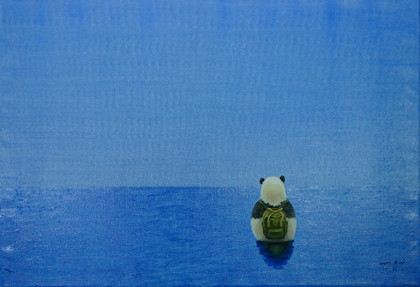Ewige Frage: Was ist Kunst?
Dieses Mal gestellt und beantwortet von Peter Weibel, Vorstand des ZKM, in seiner Eröffnungsrede zur elften art KARLSRUHE. Kunst, so Weibel, sei soziale Konstruktion und damit das Produkt mehrerer Parteien – eine Mehrfachbeziehung.
In Weibels Ansprache ging es um die vielfältigen Verflechtungen der Kunst – und um den Zusammenhang zwischen Kunst und Markt, von dem die art KARLSRUHE vitales Zeugnis ablegt.
Demzufolge ist es nur logisch, Karlruhe gleich den Rang als Hauptstadt der "Bildungsrepublik Deutschland" zuzubilligen, weil die städtische Kultur geprägt sei, durch das Zusammenspiel zahlreicher künstlerischer Institutionen. Selbstverständlich komme der art KARLSRUHE in diesem Netzwerk eine herausragende Rolle zu.
Messechefin Britta Wirtz definierte das Wort "Gesamtkunstwerk" neu, indem sie es für die Messe Art KARLSRUHE 2014 beanspruchte und dies sofort mit einem statistischen Zahlenwerk untermauerte.
Dass der badische Kunsthandelsplatz über die Grenzen Baden-Württembergs hinaus Strahlkraft besitzt, belegt die Statistik: Jede fünfte der 220 Galerien kommt aus dem Ausland. Von den 38 Neuausstellern ist es gar jeder Zweite.
Auch die Raubkunst-Debatte wurde nicht ausgespart und Gastredner Peter Raue spann einen weiten Bogen von der Sammlung Gurlitt über das steuerrechtliche Chaos (Mehrwertsteuer auf Kunstwerke wurde von 7 auf 19 Prozent angehoben) und kritisierte die Politik "in einer Weise zu handlen, die die Kunst ruiniert."
Im Grußwort zur Vernissage gab auch Jürgen Walter, Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Baden-Württemberg, brav ein Statement zu diesem Thema ab: "Damit die Kunst kaufbar bleibt, ist das Land Baden-Württemberg bemüht, eine steuerrechtliche Lösung zu finden im Sinne der Kunst."
Kunst, Kunst und nochmal Kunst.
Was meint Messekurator Ewald Karl Schrade? Er freut sich über die "große Renaissance der Malerei. Sowohl in den Messekojen der 220 Aussteller aus 13 Ländern als auch beim ARTIMA art meeting und in der Sonderschau der Sammlung Nannen behauptet sich das traditionsreiche Medium glänzend.
Ganz angetan ist auch Frank Schmidt, Direktor der Emdener Kunsthalle, vom Zuspruch und dem riesigen Andrang von der ersten Messeminute an.
Zahlen und Namen
Die sechsteilige Foto-Serie "Indoor #1-6" von Ralf Peters wird für 42.000 Euro bei der Berliner Galerie Kornfeld angeboten.
Die Schweizer Galerie Henze & Ketterer wartet erneut mit Hochkarätigem auf. Mit 2,5 Millionen Euro ist Ernst Ludwig Kirchners "Berghirte im Herbst (Berghirte mit Ziegen)" von 1921 veranschlagt. Max Pechsteins "Weintraube (Stilleben in Rot)" von 1917 ist für 475.000 Euro zu haben, und Karl Schmidt-Rottluffs "Stilleben mit Holzplastik" von 1949 kostet 450.000 Euro.
In der Galerie Nothelfer ist eine Arbeit von Kazuo Shiraga ist hier für 1,2 Millionen Euro angeboten.
HAP Grieshabers "Adam" und "Eva" – zwei Druckstöcke für die Schwarzplatte des linken und rechten Flügels zum Triptychon "Weltgeschichte" (1970) – wurden für jeweils 30.000 Euro verkauft.
Ein Werk von Markus Lüpertz, der persönlich auf der Messe anwesend war, konnte der Kölner Galerist für 60.000 Euro verkaufen. Eine kleinformatige Arbeit von Gerhard Richter wechselte für 59.000 Euro den Eigentümer.
Ein Gemälde von Norbert Bisky wechselte für 55.000 Euro den Besitzer, und die Skulptur "Langestreckt" von Helge Leiberg wurde für 13.500 Euro verkauft.
Hans Maulberger verzeichnet Verkäufe im sechsstelligen Bereich. Werke von Emil Schumacher und Heinz Mack wechselten bereits am Vernissage-Abend den Besitzer. Ein Gemälde von Conrad Westpfahl erzielte Maulberger 60.000 Euro, ein Werk von Rolf Cavael 45.000 Euro. Fred Thielers Papierarbeit "New-s/II/64" erbrachte 29.000 Euro, Michael Croissants Bronzefigur "Kopf" (1975) 10.800 Euro.
Johann Döbele konnte Max Ackermanns "Ohne Titel (Sonnenblumenmädchen)" von 1932 für 100.000 Euro abgeben, und die "Gruppierung" (1964-67) von Eugen Batz ging für 90.000 Euro an eine Privatsammlung.
Preise und Namen
Der Hans Platschek-Preis - dotiert mit 5.000 Euro - ging 2014 an Sandra Boeschenstein. Die 1967 geborene Zeichnerin beherrsche nicht nur die Arbeit mit Feder und Stift, sie sei auch eine Meisterin der Worte, erläuterte Solo-Jurorin Ulrike Groos in der Laudatio.
"Das Zeichenblatt wird bei Boeschenstein zur Welt-Bühne, auf der schließlich auch Bild und Sprache zusammentreffen", beschrieb sie die erzählerischen Text-Bild-Dialoge, zarte,schwarzweiße Werke, ergänzt durch Sätze, Satzfragmente und Aphorismen.